Keine Frage – Kunststoffe bzw. Plastik sind eine wahnsinnig nützliche Erfindung für unseren Alltag. Leider gehören sie auch zu den schlimmsten Verursachern von Umweltproblemen, da sie auf natürlichem Wege kaum oder erst nach sehr langer Zeit abgebaut werden können. Besonders gefährlich sind Mikroplastikpartikel, die Grundwasser und Böden verunreinigen und so auch in unseren Körper gelangen. Welche Folgen das genau hat, ist noch nicht abzusehen. Grund genug, Plastik soweit es geht aus unserem Alltag zu verbannen.
Das gilt auch für die Weihnachtszeit, in der viele ein Auge zudrücken und zu ihren alten Gewohnheiten zurückkehren. Dabei wird in dieser Zeit besonders viel eingekauft und konsumiert, sodass ein Verzicht auf Plastik eine noch größere Wirkung haben kann als während des restlichen Jahres. Anregungen zur Umsetzung findet Ihr in unseren Artikeln zum nachhaltigen Schenken, Dekorieren und Kochen in den kommenden Tagen und Wochen. Doch zuvor wollen wir Euch erst einmal informieren, was Mikroplastik eigentlich ist, wo es herkommt und welche Auswirkungen es haben kann.
Mikroplastik – eine fast unsichtbare Gefahr
Plastikmüll hat verheerende Folgen für unsere Umwelt. Das ist für Euch mit Sicherheit nichts Neues. Fast jeder hat schon einmal die verstörenden Bilder von vermüllten Sandstränden, Meerestieren mit Plastikrückständen im Magen oder im Ozean schwimmenden Inseln aus Plastikmüll gesehen. Dabei wird schnell klar, dass vor allem die Weltmeere stark unter unserem Plastikverbrauch leiden. Sie sind ein sensibles Ökosystem, das es zu schützen gilt. Neben den sichtbaren Plastikrückständen ist vor allem Mikroplastik (so werden Plastikpartikel bezeichnet, die kleiner als 5 mm sind) ein Problem. Die Rückstände verunreinigen Grundwasser, Böden und Meere, weil sie zu klein sind, um vollständig gefiltert zu werden.
Es gibt zwei Arten von Mikroplastik. Das sogenannte primäre Mikroplastik sind verschwindend kleine Plastikpartikel, die in vielen Produkten enthalten sind, um deren Eigenschaften zu optimieren. Man findet sie zum Beispiel in Zahnpasta, Haarprodukten, Peelings oder auch Babywindeln. Beim Gebrauch oder Recycling dieser Produkte bleiben die Mikroplastikpartikel übrig, gelangen ins Grundwasser und lagern sich in den Böden ein. Was viele nicht wissen: Zu den größten Verursachern gehören Autoreifen, bei deren Abrieb eine beachtliche Menge an Mikroplastikpartikeln freigesetzt wird.
Sekundäres Mikroplastik entsteht hingegen beim Zerfall von größeren Kunststoffprodukten wie Verpackungen, Einwegflaschen oder Einkaufstüten. Dieser Plastikmüll wird von Witterung und UV-Strahlung zersetzt, sodass immer kleinere Plastikpartikel übrigbleiben.
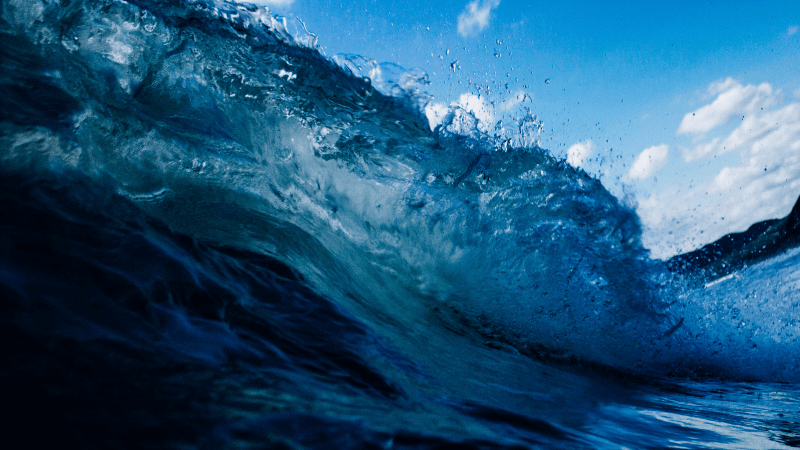
Der Weg vom Land ins Meer
Etwa 80 Prozent des Plastikmülls und der Mikroplastikpartikel im Meer werden an Land verursacht. Wie bereits erwähnt, stammen sie zum Beispiel aus unserem täglichen Gebrauch von Kosmetik- und Badartikeln, aber natürlich auch aus der verantwortungslosen “Entsorgung” von Plastikflaschen und -tüten, die in vielen Ländern ohne organisierte Mülltrennung und -entsorgung in Straßengräben, Flüssen oder direkt an den Stränden landen.
Viele Mikroplastikpartikel sind zu klein, um von den Filtersystemen in Klär- oder Recyclinganlagen erfasst zu werden. Über das Abwasser gelangen sie in Flüsse und lagern sich dann entweder in den Böden der Flussufer ein oder werden mit der Strömung in die Weltmeere befördert.
Auch der Wind spielt eine Rolle bei der weltweiten Verbreitung von Plastikmüll. Er verweht leichte Plastikabfälle von wilden Müllsammelplätzen oder Partikel, die beim Reifen- und Schuhsohlenabrieb entstehen, ins Meer.
Doch es gibt auch Plastikmüll, der direkt auf hoher See entsteht. So gibt es zum Beispiel Offshoreanlagen oder Schiffe, die ihren Müll trotz aller Verbote illegal ins Meer leiten. Die Hauptquelle sind allerdings Fischernetze, die meist versehentlich vom Schiff gelöst werden und dann als sogenannte Geisternetze im Meer treiben. Das ist nicht nur ein Problem für die Verbreitung von Plastikmüll im Meer, sondern auch eine direkte Gefahr für Meerestiere. Sie verfangen sich in den ziellos treibenden Netzen und strangulieren sich beim Versuch, sich zu befreien. Besonders betroffen sind größere Tiere wie Wale, Haie, Delfine, Schildkröten und Robben.
Was passiert mit Plastik im Meer
In den Weltmeeren gibt es fünf große Strömungen, die im Nordpazifik, Südpazifik, Nordatlantik, Südatlantik und im Indischen Ozean jeweils einen großen Wirbel bilden. Aus diesem Grund sammelt sich der Plastikmüll im Zentrum dieser Wirbel zunächst an der Wasseroberfläche (sogenannte Müllinseln) bevor er frei in der Wassersäule schwebt und schließlich an den Meeresboden absinkt. Das ist vor allem in der Tiefsee ein Problem, wo es dunkel und kalt ist, was den Abbau der Kunststoffpartikel zusätzlich verlangsamt.
Auch hier ist der Plastikmüll eine große Bedrohung für Meerestiere, die Mikroplastik mit der Nahrung aufnehmen oder größere Plastikrückstände für Nahrung halten, was zu Erkrankungen des Verdauungstrakts und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führt. Doch selbst wenn dieser Fall nicht eintritt, können Plastikpartikel im Körper der Fische verbleiben, die wir später als Nahrung aufnehmen.
Es gibt noch keine ausreichenden Daten dazu, wie lange der Plastikmüll im Meer verbleibt, bis er vollständig abgebaut ist, da das Problem erst seit einigen Jahrzehnten besteht. Die meisten Kunststoffe sind extrem widerstandsfähig und langlebig. Diesen Eigenschaften haben sie ihren Erfolg zu verdanken, doch die langfristigen Folgen für Umwelt und Gesundheit können Forscher bisher nur theoretisch abschätzen.

Was können Verbraucher tun?
Um die Natur und nicht zuletzt auch Eure Gesundheit und die nachfolgender Generationen zu schützen, hilft nur der aufgeklärte und bewusste Einsatz von Plastik im Alltag. Es gibt viele Fälle, in denen sich die Freisetzung von Mikroplastik nicht vermeiden lässt. Umso wichtiger ist es, Plastik an den Stellen zu vermeiden, an denen es möglich ist. Dazu zählen zum Beispiel kleine alltägliche Gewohnheiten: verwendet Stofftaschen für Eure täglichen Einkäufe, kauft Getränke in Glas- oder Pfandflaschen, trennt Euren Müll für ein möglichst effizientes Recycling.
Vor allem vor großen Festen wie Weihnachten ist es wichtig, bewusst zu konsumieren und Plastik so gut wie möglich zu vermeiden. Bastelt Eure Weihnachtsdeko aus natürlichen Materialien selbst, kauft lieber wenige hochwertige Geschenke und verwendet alte Papier- und Stoffreste für die Geschenkverpackung. Konkretere Tipps, wie Ihr die Advents- und Weihnachtszeit nachhaltig gestalten könnt, findet Ihr in den nächsten Tagen und Wochen in unserem Adventskalender.
Langfristig könnt Ihr einen Beitrag leisten, indem Ihr Organisationen und Initiativen unterstützt, die Lösungen des Plastikmüllproblems bieten. Schaut nicht weg, wenn Ihr im Urlaub Plastikmüll am Strand seht, sondern teilt die Bilder mit Freunden und Bekannten, um das Bewusstsein für das Problem zu schärfen. Beteiligt Euch an Strandaufräumaktionen oder unterstützt sie durch Spenden. Achtet beim Einkauf von Lebensmitteln auf Umweltsiegel, die die Nachhaltigkeit der Produkte kennzeichnen.
Im Rahmen einer MSC-Fischereibewertung wird das Risiko des sogenannten „Geisterfischens“ berücksichtigt. Eine MSC-zertifizierte Fischerei muss Kenntnisse über das Ausmaß des Fanggeräteverlustes und dessen Auswirkungen auf Lebensräume, Ökosysteme oder bedrohte Arten haben. Mehrere MSC-zertifizierte Fischereien haben Methoden eingeführt, um die Auswirkungen von verloren gegangenen Fanggeräten zu reduzieren. Die Kabeljaufischerei in Alaska musste als Bedingung für eine MSC-Zertifizierung den Verlust ihrer Fanggeräte überwachen und die Auswirkungen auf das Ökosystem beobachten und analysieren. Kabeljau-Fallen in diesen Fischereien verfügen nun über biologisch abbaubare Fluchtklappen und Rettungsringe, um das Risiko des „Geisterfischens“ zu minimieren.
In der MSC-zertifizierten Hummerfischerei in der Normandie und in Jersey sind alle Hummerfallen mit einer Bootsregistrierung und einem Jahr versehen. Fischer müssen verlorene Fallen melden und es steht nur eine begrenzte Anzahl von Ersatz-Tags zur Verfügung. Dieses System motiviert die Fischer, ihre Fallen nicht zu verlieren.


